Wer war der Erste, der eine Geschichte in einer Welt ansiedelte, die nicht die unsre ist?
Wenn wir uns ein wenig mit dem Genre beschäftigen, stellen wir zunächst fest, dass es nicht die eine Geschichte der Fantasy-Literatur gibt. Jeder leitet alles, was wir heute bewundern können, von einem anderen Vorfahren ab.
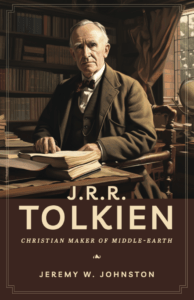
Dennoch gibt es Unterschiede in der Definition, denn die enorme Bandbreite der Fantasy enthält natürlich verschiedene Merkmale, die für die Bestimmung des Genres wesentlich sind. Die „High Fantasy“ kann im Großen und Ganzen dadurch definiert werden, dass sie in einer Welt spielt, die nicht die unsere ist. Es ist eine Welt mit eigener Geographie und eigener Kulturgeschichte. Es ist also eine andere Welt, in der die Geschichte spielt. Viele Kritiker gehen davon aus, dass mit „High Fantasy“ der Kern umrissen ist, wenn wir von Fantasy sprechen. Das ist aber noch etwas vage. Eine zweite oder fremde Welt ist nicht unbedingt eine andere Welt.
Tolkien wollte mit seinem Entwurf von Arda eine Welt darstellen, die in einer prähistorischen und mythischen Zeit unserer Erde angesiedelt ist. Ebenso spielen Robert E. Howards Geschichten um Conan und Kull in einer Zeit vor aller historischen Geschichtsschreibung, und auch die meisten (wenn auch nicht alle) Erzählungen von Clark Ashton Smith haben einen klaren Bezug zur sogenannten Realität. Smith findet seine Schauplätze überall im existierenden Universum: in der Vergangenheit (Hyperborea, Poseidonis), in der fernen Zukunft (Zotique), auf anderen Planeten, darunter bekannten (Mars) und unbekannten (Xiccarph).
Die Wahl des Settings rechtfertigt die Idee der Fantasy und macht es den meisten Lesern leichter, das Unglaubliche zu akzeptieren, wenn es einen Bezugspunkt zur – wie gesagt – sogenannten Realität gibt. Das Setting gibt der Fantasy also einen Rahmen, der nachvollzogen werden kann. Das wirft eine Frage auf: Wer war der erste, der diesen Rahmen völlig verwarf und den Schritt jenseits aller Realität wagte? Oder besser: Wer war der Erste, der eine Geschichte in einer Welt angesiedelt hat, die nicht die unsere ist?
Was ist eine erfundene Welt?
Lin Carter, der sich zusammen mit L. Sprague de Camp mit dem Nachdruck und der Sammlung alter Fantasy-Werke beschäftigte, beantwortete die Frage so: Der erste, der eine solche Geschichte schrieb, war William Morris, der Autor von „Die Quelle am Ende der Welt“ und „Die Zauberin jenseits der Welt“. (Und auch die deutsche Übersetzung wirbt mit dem Etikett “Begründer der Fantasy”). Auf den ersten Blick wirken diese beiden Romane tatsächlich wie „High Fantasy“. Aber spielen sie wirklich in einer anderen Welt?
Zunächst stellt sich die Frage, was eine erfundene oder von uns unabhängige zweite Welt ist. Natürlich eine mit eigener Geographie und Geschichtsschreibung, die sich von der unseren völlig unterscheidet. Aber wie groß müssen die Unterschiede sein? Man könnte meinen, dass Bücher entweder aus dem Drang heraus geschrieben werden, die Welt nachzuahmen, oder um etwas Neues zu schaffen, und dass wir am Ende von Realismus oder Phantastik sprechen. Aber das wäre unbefriedigend, denn natürlich beruht jede Literatur in erster Linie auf Erfindung, ob sie sich nun realistisch nennt oder nicht.
Gehen wir also davon aus, dass jeder literarische Schauplatz eine Art Ersatz- oder Zweitwelt ist, in dem Sinne, dass diese Welt der Phantasie und dem Können des Autors entspringt. Auch in journalistischen Arbeiten und Sachtexten existiert das Dargestellte nur im Kopf des Autors (und des Lesers). Das bedeutet, dass jede Umgebung geeignet ist, in einer Phantasiewelt angesiedelt zu werden. Nehmen wir an, wir lesen ein Buch, das in Berlin spielt, und wir kennen Berlin gut genug, um die Orte Alexanderplatz oder Brandenburger Tor und schließlich die gesamte Geographie so weit zu verfolgen, dass wir sie als korrekt dargestellt erkennen.
Nehmen wir weiter an, die Geschichte lehrt uns, dass Berlin 15 Millionen Einwohner hat und dass der dortige Fußballverein Hertha in den letzten Jahrzehnten regelmäßig Deutscher Meister geworden ist. Jeder Berliner oder Fußballfan weiß spätestens jetzt, dass dies nicht den Tatsachen entspricht. Handelt es sich also um Irrtümer oder lesen wir hier über eine Phantasiewelt? Andererseits: Was wäre, wenn die Stadt „Beutelstadt“ hieße, 3,5 Millionen Einwohner hätte, den Reichstag und einen nicht ganz so erfolgreichen Fußballverein? Bedeutet der Unterschied im Namen schon eine andere Welt, wenn doch so vieles gleich ist?
Diese Fragen können je nach Text unterschiedlich beantwortet werden. Es gibt natürlich ein prominentes Beispiel: Thomas Hardy hat viele seiner Bücher im Südwesten Englands angesiedelt, die Gegend aber „Wessex“ genannt, und er verwendet oft real existierende Orte mit fiktiven Namen – die Stadt Dorset wird zum Beispiel zu „Casterbridge“. „Kein Detail ist sicher“, schrieb er, „die Beschreibungen von Städten und Dörfern mit fiktiven Namen sind nur durch reale Orte inspiriert und werden schamlos für ihre eigenen Zwecke benutzt.
Betrachten wir einen anderen Schriftsteller, der nicht gerade als Erfinder von Welten bekannt ist: William Faulkner. Viele seiner Erzählungen spielen in „Yoknapatawpha“, einem erfundenen Land, das auf dem real existierenden Lafayette County basiert. Faulkner erfand eine Geschichte für sein Land und entwarf sogar eine Karte, die in seinem Buch „Absalom, Absalom! (Auch Hardy hatte eine Karte von Wessex).
Das sind nicht die zweiten Welten, die wir suchen (oder was die meisten darunter verstehen würden), aber sie weisen in die richtige Richtung. Sie gehören nicht zu den unabhängigen phantastischen Welten. Sie sind Teil der real existierenden Welt. Ihre Geschichte gehört zu dem Land, in dem sie angesiedelt sind, ihre Gesellschaft ist die der realen Welt zu dieser Zeit. Das Ziel der Autoren war es, so nah wie möglich an der Realität zu bleiben, auch wenn sie sich einige Freiheiten nahmen, die zu ihrem kreativen Repertoire gehörten.
William Morris
Kehren wir zu William Morris zurück. Betrachten wir seine drei berühmten phantastischen Werke „Die Zauberin jenseits der Welt“, „Die Quelle am Ende der Welt“ und „Das Reich am Strom“. Sind sie völlig unabhängig von der realen Welt? Alle diese Bücher rühmen sich ihrer erfundenen Geographie (Das Reich am Strom hat sogar eine Karte). Die sozialen Komponenten sind ausgefeilt und unverwechselbar, ähnlich dem europäischen Mittelalter in Bezug auf Technologie, Klassen, etc. Alles sieht so aus, als hätten wir es hier mit der gesuchten unabhängigen zweiten Welt zu tun.
„Das Reich am Strom“ bezieht sich auf der ersten Seite auf Weihnachten und den Apostel Thomas von Indien. Auf der nächsten Seite erfahren wir, dass die Aufzeichnungen von einem Mönch aus Abington in England stammen. Auf einer anderen Seite sagt der Mönch, dass er die Geschichten gesammelt hat; man könnte also sagen, dass diese Erzählung aus einer anderen Welt von einem Mann aus unserer Welt geschrieben wurde.
Auf der Suche nach einer Welt, die nichts mit der unseren zu tun hat, kommen wir hier also nicht weiter. Die Verwendung eines Mönchs ist ein Beispiel dafür, wie eine Phantasiewelt versucht, sich mit der Realität zu verbinden. Das Reich am Fluss können wir also beiseite lassen.
„Die Zauberin jenseits der Welt“ erwähnt eine Taufe und verwendet den Begriff „Söhne Adams“. Ebenso bezieht sich die Erzählung auf die “Perlen der Sarazenen” und erwähnt sowohl die Stadt Rom als auch Babylon; der Roman bezieht sich auch auf heidnische Götter wie Diana und Venus und sogar auf Details des christlichen Glaubens (wie die Dreifaltigkeit und die Messe). Das klingt nicht nach einer unabhängigen Welt.
Lin Carter dachte aber so. In seiner Einführung zu „Die Quelle am Ende der Welt“ erklärte er:
“Obwohl der Text einige verstreute Hinweise auf Babylon, den Papst und verschiedene Heilige enthält, und obwohl die meisten Namen der handelnden Figuren in unserer Welt bekannt sind, handelt es sich bei der Quelle am Ende der Welt um eine jener reizvollen literarischen Landschaften, der es irgendwie gelungen ist, um den gewohnheitsmäßigen Verschleiß herumzukommen.”
Das hört sich gut an. Einige verstreute Hinweise auslegen, ist das, was man tut, wenn man eine literarische Welt erfindet. Aber wenn sich die Hinweise auf die reale Welt beziehen, können wir dann nicht davon ausgehen, dass es sich mehr oder weniger auch um unsere Welt handelt? Wo liegen die Grenzen?
Man könnte argumentieren, dass dieses Rom der Quelle am Ende der Welt nichts mit dem Rom unserer Welt zu tun hat. Tatsächlich reist niemand aus der Erzählung dorthin. Die Geographie des Buches ist ziemlich begrenzt. Es gibt das Land Upmeads und die umliegenden Ländereien, aber niemand sagt etwas über das, was um sie herum liegt. Wir erfahren nur, dass Rom etwa 500 Meilen entfernt ist.
Parallelwelten
Es ist einfach, sich Upmeads als ein kleines Königreich wie England oder Frankreich oder ein anderes europäisches Land vorzustellen, und natürlich kann man sich Upmeads auch als eine eigene Welt vorstellen, wenn man akzeptiert, dass es dort Städte wie Rom oder Babylon gibt. Aber wie sinnvoll ist das?
Ich denke, wir sollten etwas sparsamer sein, statt “nicht unnötig viele Begriffe” sollten wir sagen: “nicht unnötig viele Realitäten”. Wenn ein realer Ort in einer Geschichte verankert ist, sollten wir davon ausgehen, dass es sich um einen realen Ort handelt, es sei denn, die Geschichte belehrt uns eines Besseren.
Natürlich kann eine Geschichte, die in einer Parallelwelt spielt, reale Namen für erfundene Orte enthalten, aber Parallelwelten kamen erst relativ spät auf, zumindest lange nach den Fantasy-Welten. Aber auch hier: Wo ist die Grenze zu ziehen? Wenn wir eine Geschichte vor uns haben, in der Magie wirklich funktioniert, die Welt aber eindeutig unsere ist, sollen wir sie dann als eine Geschichte lesen, die in einer Fantasywelt spielt, oder als eine Geschichte, die in der realen Welt spielt?
Das hängt wohl davon ab, ob das Setting die reale Welt in uns hervorrufen will und nicht eine Parallelwelt. Wenn das der Fall ist, müssen wir die Welt als die reale Welt akzeptieren, d.h. als die Beschreibung einer fiktiven, aber realen Welt, in der Magie funktioniert. Der Unterschied zu einer Parallelwelt (wie auch zu einer Fantasy-Welt) besteht darin, dass beide einer eigenen, ihrer Geschichte innewohnenden Logik folgen und ihre Protagonisten erkennbar anders handeln als die Menschen in unserer Welt. Wenn die Magie dort so weit entwickelt ist, dass sich durch sie die Kulturgeschichte oder der Lauf der Welt völlig anders entwickelt hat, dann haben wir es auf sehr wirkungsvolle Weise mit einer phantastischen Parallelwelt zu tun.
Wenn wir eine Geschichte über König Artus lesen, die in England spielt, wo Merlin seinen Zauber wirkt, lesen wir nicht unbedingt über eine erfundene zweite Welt. Wenn wir Susanna Clarkes „Jonathan Strange & Mr. Norell“ lesen, scheint die Handlung in Jane Austens England zu spielen, mit der Stadt London und den napoleonischen Kriegen. Doch schnell merken wir, dass hier nicht nur Magie wirkt, sondern dass es auch eigene historische Entwicklungen zu geben scheint, die eine eigenwillige Interpretation der uns bekannten darstellen. Wir haben es hier eindeutig mit einer Parallelwelt zu tun.
Braucht eine phantastische Anderswelt eine eigene Geographie? Strange & Norell nicht. Braucht sie eine verständliche Kulturgeschichte? Nun, von Alice im Wunderland kann man nicht behaupten, dass es eine solche gibt. Kann eine Fantasy-Welt also auf eine eigene Geographie und Kulturgeschichte verzichten? Was ist mit den Menschen? Können sie sich so verhalten wie die Menschen in der realen Welt oder müssen sie ihre eigenen Sitten und Gebräuche haben? Wenn ja, wie stark müssen sie sich von realen Menschen unterscheiden?
Die Merkmale einer phantastischen Welt
Es scheint vier charakteristische Merkmale zu geben, bei deren Berücksichtigung man von einer unabhängigen Welt sprechen kann, vorausgesetzt, dass es sich nicht ausdrücklich um unsere Welt handelt, z.B. in einer anderen Zeit oder in einem unbekannten Teil unserer Welt. Diese Welt darf auch nicht in einem Traum (oder in einer Illusion dieser Welt) angesiedelt sein. Mit anderen Worten, wenn nichts darauf hinweist, dass diese Welt unsere Welt ist, wird eine Fantasy-Welt alle oder die meisten der folgenden Merkmale aufweisen:
Erstens scheint es, dass eine unabhängige phantastische Welt immer ihrer eigenen Logik folgt. Das kann bedeuten, dass hier andere physikalische Gesetze gelten oder dass die Magie ein Äquivalent zur Physik oder Wissenschaft darstellt. Oder die Logik entspricht eher einer Traumlogik. Der Punkt ist, dass die Funktionsweise dieser Welt, ihre Gesetze usw. sich von unserer Welt unterscheiden. In einem solchen Fall kann man von einer eigenständigen Phantasiewelt sprechen.
Zweitens: Geographie. Eine eigenständige Fantasy-Welt hat eigentlich immer ihre eigene Geographie. Es gibt einen Ort – und dann gibt es den Ort da drüben usw., vorzugsweise sind alle diese Orte benannt, obwohl das, was diese Namen ausmacht, eine eigene Diskussion wert wäre.
Drittens: Die Welt hat eine Geschichte. Diese Geschichte kann akribisch und ausgiebig sein, oder sie kann beschaulich sein, aber der Punkt ist, dass das, was in dieser Welt geschieht, vor einem historischen Hintergrund geschieht. Es wurde Handel getrieben, Völker bekriegten sich oder waren anderweitig verfeindet. Der Rahmen dieser Ereignisse hilft der Erzählung und dem Weltentwurf insgesamt.
Viertens: Menschen können sich anders verhalten als wir. Sie haben vielleicht ihre eigenen Bräuche, denken anders als wir, haben einen anderen Stand der Technik oder haben die Dinge in einer anderen Reihenfolge erfunden als wir. Vielleicht ist ihre Sprache anders, archaischer und spiegelt ihre andere Denkweise wider. Vielleicht gibt es aber auch nichts von alledem. Was ich zu beschreiben versuche, sind Menschen, die wir uns als Teil ihrer eigenen fiktiven Welt vorstellen sollen und die sich mehr auf diese Welt beziehen als auf die reale Welt. Aber die Bewohner von Tolkiens Mittelerde sind keine Europäer, und wir sollen sie auch nicht als solche betrachten, obwohl sie in vielerlei Hinsicht Europäern ähneln.
Jetzt haben wir unsere vier Merkmale, die hoffentlich definieren, was es bedeutet, mit einer unabhängigen zweiten phantastischen Welt konfrontiert zu sein. Wie funktioniert das in der Praxis? Braucht eine fiktive Welt alle diese Merkmale?
Dazu kommen wir im nächsten Teil.
Entdecke mehr von Phantastikon
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

