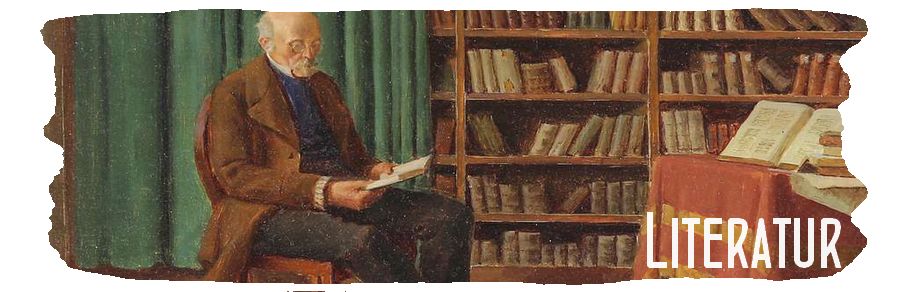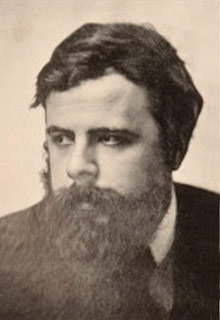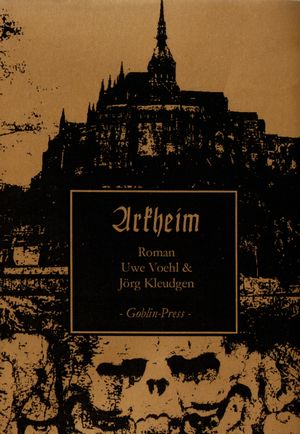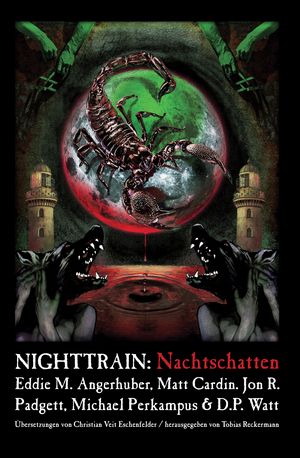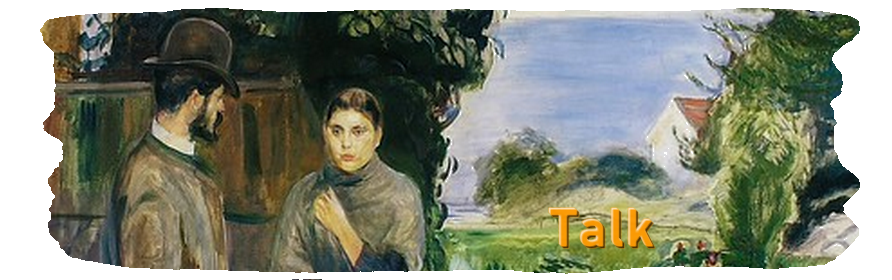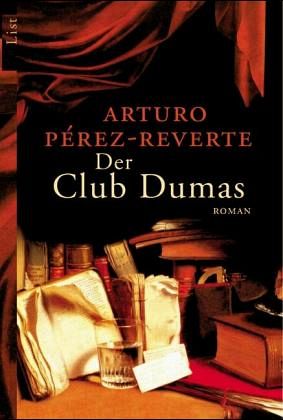
Zu Beginn lässt sich sagen, dass – Polanski in allen Ehren – der Film “Die neun Pforten” aus dem Jahre 1999 das Buch ziemlich zerstört hat. Meistens ist es so, dass Filme einem guten Buch nichts anhaben können, hier ist es anders. Als der “Club Dumas” 1993 erschien, hat ihn – in Deutschland – niemand wirklich gelesen. Es gibt dann immer diejenigen, die durch den Film auf das Buch aufmerksam werden, was den Verlagen natürlich in die Karten spielt. Das Problem bei einem handlungsgetriebenen Plot: man kennt die Stationen schon und bringt sich um das Lesevergnügen. Natürlich lässt der Roman einige Dinge anders ablaufen und vertieft sie. Polanski hat ziemlich viel weggestrichen und geändert, so dass sich das Buch dennoch lohnt, aber der Film ist nicht das einzige Problem des Romans. Man hat ihn schon als “Umberto Eco Light” bezeichnet, und das ist gar nicht so weit hergeholt. Um die Jahrtausendwende wurden Verschwörungs-Thriller populär, obwohl Eco sein “Foucaultsches Pendel” bereits 1988 vorlegte. Auch den “Club Dumas” hat man versucht, als “literarischen” Thriller zu vermarkten, aber gegen Ecos Arbeiten wirkt das fast wie ein Witz. Am besten, man lässt die Vergleiche und schaut sich an, worum es geht.