Die Todesfee der Grindlay Street / Oscar de Muriel

Oscar de Muriels Die Todesfee der Grindlay Street (2016) führt die ungleichen Ermittler Ian Frey und Adolphus „Nine-Nails“ McGray in ein Edinburgh des Jahres 1889, das von winterlicher Kälte und einem unterschwelligen Schaudern durchzogen ist. Im Irrenhaus von Edinburgh entkommt die Insassin Irma Starling nach einem blutigen Mord und lässt die Stadt in Aufruhr zurück. Die Jagd nach ihr führt Frey und McGray hinaus aus der urbanen Enge in die verschneiten Highlands, wo sich die Spuren von moderner Wissenschaft und uralten Mythen kreuzen. Wie schon im ersten (Die Schatten von Edinburgh) und zweiten (Der Fluch von Pendle Hill) Band nutzt de Muriel das klassische Gerüst des viktorianischen Kriminalromans, um es mit Elementen des Schauerromans zu verschränken.
Im Zentrum steht erneut das Spannungsfeld zwischen Rationalität und Aberglauben. Frey, der Londoner Gentleman und bekennende Skeptiker, erzählt die Geschichte mit ironischer Distanz und verkörpert die aufstrebende Vernunft der späten viktorianischen Ära. McGray dagegen glaubt fest an Geister und dunkle Mächte und vertritt damit die Seite einer schottischen Volkskultur, die sich nicht von alten Legenden trennen will. Zwischen den beiden entsteht ein ständiger Dialog, der sowohl Witz als auch philosophische Tiefe besitzt. Die entflohene Irma Starling bleibt lange ein Rätsel: Ist sie eine geisteskranke Verbrecherin, ein Opfer missverstandener Psychiatrie oder tatsächlich ein Medium, das übernatürliche Kräfte besitzt? De Muriel hält diese Schwebe mit großem Geschick, sodass der Leser bis zum Schluss nicht weiß, ob er sich in einem reinen Kriminalfall oder in einer übernatürlichen Tragödie bewegt.
Schneestürme, flackernde Gaslampen und das bedrohlich knarrende Gemäuer des Asyls schaffen ein Setting, das an Wilkie Collins oder die frühen Geschichten von Arthur Conan Doyle erinnert, zugleich aber die düsteren Highlands in Szene setzt, wie sie schon der arme schottische Dichter James Hogg beschworen hat. De Muriels Prosa ist dabei weniger literarisch kunstvoll als handwerklich perfekt: Er versteht es, Dialoge mit trockenem Humor zu spicken und Actionpassagen so zu gestalten, dass die Spannung nie ganz abreißt. Gerade die Wortgefechte zwischen Frey und McGray verleihen dem Buch erneut eine Leichtigkeit, die den dunklen Stoff ausbalanciert.
Inhaltlich bleibt der Roman auch ein Kommentar auf die Grenzziehungen seiner Zeit. Die junge Disziplin der Psychiatrie, hier in Gestalt der Anstalt und ihrer Ärzte, kämpft um wissenschaftliche Legitimation, während Volksglauben, Spiritismus und keltische Überlieferungen im Untergrund weiterwirken. Wahnsinn und Identität, Verbrechen und Krankheit, Täuschung und Wahrheit – all diese Kategorien erscheinen unscharf, und am Ende ist die Lösung des Falls ebenso von Zweifeln durchzogen wie die menschlichen Seelen, die er untersucht. Wer eine eindeutige Aufklärung im Stil eines klassischen Whodunit erwartet, könnte sich an der bewusst ambivalenten Auflösung stoßen, doch gerade dieses Changieren zwischen Erklärbarkeit und Mysterium verleiht dem Buch seinen Reiz.
Wir haben hier also einen atmosphärisch dichter Roman über das Ringen von Vernunft und Aberglauben vor uns, über die Faszination des Ungewissen und über die Masken, die Menschen tragen, um ihre inneren Dämonen zu verbergen. De Muriel liefert ein glänzend komponiertes Stück Unterhaltung, das Fans von Conan Doyle ebenso erfreuen dürfte wie Liebhaber klassischer Gothic-Geschichten, die an den Rändern der Realität ausfranzen.
Als Hörbücher wird die Serie herrausragend vorgetragen von Günter Merlau, der hier als Erzähler die beiden unterschiedlichen Hauptfiguren derart gut im Griff hat, dass die Stimmen, die er ihnen gibt, fast schon als Ikonisch betrachtet werden müssen.
Entdecke mehr von Phantastikon
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
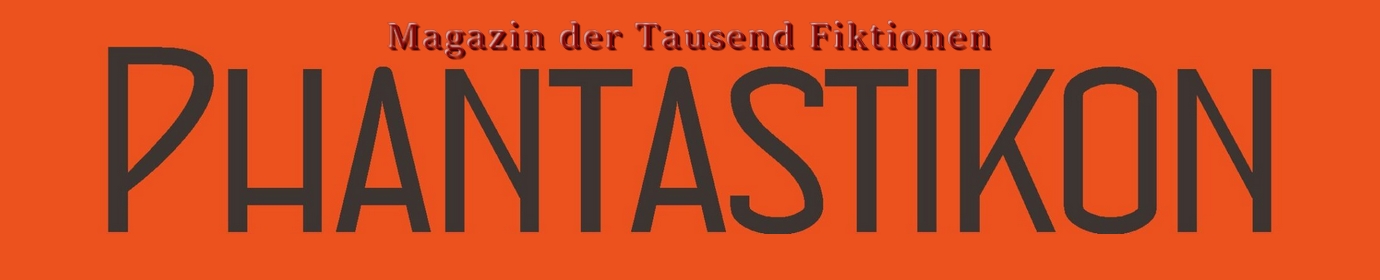
























.jpg)