Der Wurm Ouroboros

Dies ist ein Werk heroischer Fantasy, das von Künstlern wie J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis und Ursula LeGuin als Inspiration für ihre eigene Arbeit ausgelobt wurde. Und sicherlich finden sich die Ideen des Transfers in eine fremde Welt, heroische Suchen und große, oft scheinbar aussichtslose Auseinandersetzungen gegen böse Mächte als Wurzeln zu großen Teilen in diesem Werk.
Es ist ein seltsames Buch, und das war es bereits 1922, als es zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Allerdings ist es für manche ein sehr befriedigendes seltsames Buch. Der Autor war ein englischer Beamter, außerdem übersetzte er nordische Sagen und galt als Experte für mittelalterliche und Renaissance-Poesie, hatte also viel mit C. S. Lewis gemeinsam. tatsächlich kannte er Lewis und Tolkien persönlich und interagierte mit ihrem Inklings-Kreis. Anders als diese beiden war er jedoch entschieden kein Christ und könnte am ehesten als neoheidnisch angesehen werden – wie auch dieses Buch.
“Der Wurm Ouroboros” gilt zusammen mit William Morris’ “Die Quelle am Ende der Welt” als einer der ersten High Fantasy-Romane.
“Ouroboros” bezieht sich dabei auf den Wurm (ein Begriff, der oft für Drachen oder Schlangen verwendet wird), der seinen eigenen Schwanz schluckt und dadurch einen endlosen Ring bildet. Damit ist es ein Zeichen des ewigen Kreislaufs, repräsentiert aber auch Jörmungandr, die Midgardschlange der nordischen Mythologie, die sich um die Erde windet. Sobald sie ihren Schwanz loslässt, wird sie damit Ragnarök auslösen. Auch spiegelt sich diese Sage in der Artuslegende wider. Im Roman ist es das Symbol, das der König von Hexenland trägt, und die Idee eines endlosen Zyklus steht demzufolge auch am Ende des Werkes.
Während die Themen also nicht ganz original sind, ist es der Inhalt durchaus. Eddison schuf eine ganz neue Welt (wie es die Natur der High Fantasy ist), bevölkert von komplexen Helden mit Fehlern und Schurken mit Tugenden, die nach Macht, Liebe und vor allem Transzendenz durch heroische Taten, indem sie sich gegen unüberwindliche Widrigkeiten stellen. Wie bei jedem guten High Fantasy-Roman sind die Charaktere nicht flach, sondern erkennbare Archetypen, mit denen sich der Leser identifiziert, weil er in ihnen Attribute erkennt, die er selbst hat oder die er gerne hätte. Sicher, es handelt sich hier um seltsame Menschen mit seltsamen Namen, und doch sind sie uns nicht wirklich fremd.
Das schwierigste an diesem Buch ist die Tatsache, dass es ganz bewusst im jakobinischen Englisch des 16. Jahrhunderts geschrieben ist. Der Text wirkt allerdings nicht etwa aufgesetzt künstlich, er rutscht nie aus der von ihm dargestellten Welt, ganz im Gegenteil ist die Sprache dazu angetan, diese befremdliche Stimmung zu vermitteln. Man benötigt etwas Eingewöhnungszeit, denn die Satzstruktur und die obskuren Wörter liest man nicht alle Tage. Natürlich geht das in der Übersetzung zum größten Teil unter, aber der Übersetzer Helmut W. Pesch hat stets adäquate Entsprechungen gefunden, so weit das zu beurteilen ist. Das Buch ist nicht eigentlich schwer zu lesen, aber man braucht Zeit. Und es ist der Mühe wert. Zu Beginn mögen all die dichten Beschreibungen übertrieben erscheinen, aber nur so entfaltet das Werk seine ganze suggestive Kraft.
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurden wir an zwei grundlegende Arten der Fantasyliteratur gewöhnt. Das erste bahnbrechende Beispiel ist natürlich “Der Herr der Ringe” mit seiner ausgesprochen christlichen Sensibilität, bei der die richtige, moralische Wahl klar auf der Hand liegt. Helden und Schurken sind eindeutig voneinander getrennt, obwohl es durchaus auch Ambivalenzen gibt (ein gutes Beispiel ist Boromir). Helden bekämpfen das Böse, denn das ist für sie das Richtige. Zwar suchen sie manchmal auch ihren eigenen Ruhm, aber das ist nur ein Nebeneffekt. Diese Helden sich sich der Konsequenzen ihres Handelns bewusst, sie berücksichtigen die Auswirkungen dessen, was sie tun. Am Ende wird das Böse besiegt. Diese Art von Fantasy ist – wie Märchen auch – dazu da, die Leserschaft zu unterhalten und dabei moralisch zu unterweisen.
Der zweite Typus ist moderner und wird (im Moment) vor allem durch “Das Lied von Eis und Feuer” veranschaulicht. In diesen Texten herrscht eine amoralische, anarchische Sensibilität.
Schlechte Dinge passieren guten und schlechten Menschen gleichermaßen, und diejenigen, die auf der “guten” Seite stehen, sind nur bis zu ihrer unvermeidlichen Korruption gut. Moralische Entscheidungen sind immer unklar und niemand ist wirklich gut oder wirklich böse. Ein blindes Schicksal erdrückt alles. Ehre ist ein Mythos; das Grab erwartet uns alle, und nichts weiter. In gewisser Weise ist dies eine realistische Darstellung unseres Lebens, vor allem des modernen Lebens. Jedoch fehlt in Arbeiten wie diesen der Zauber des ersten Typs. Wir werden unterhalten, wenn auch oft mit einem bitteren Nachgeschmack, aber die Geschichte erhöht uns nicht und ist auch nicht dazu gedacht.
“Der Wurm Ouroboros” ist ein dritter Typus, der nur wenige moderne Analogien besitzt. Er ist in keinster Weise christlich, hat aber dennoch eine spezifische moralische Feinfühligkeit – die der heidnischen Nordvölker. Die Charaktere, von denen es viele gibt, kämpfen, weil der Kampf Ruhm verspricht und weil es Spaß macht. Im Grunde ist das alles, was sie tun, unterbrochen von der Liebe schöner Frauen (die selbst planen, entweder ihrer Familie Ruhm zu bringen oder Teil der Aristokratie zu werden). Natürlich gibt es ebenfalls die großen Feste in schmuckvollen Hallen. Die Elite ist alles, was zählt. Die Rolle des einfachen Volkes besteht darin, zu sterben, um den Stand der Aristokratie aufrechtzuerhalten. Das macht es für diejenigen, die die simpel gestrickte moralische Vorstellung Tolkiens mögen, und für diejenigen, die die berechnend eigennützigen Charaktere aus “Das Lied von Eis und Feuer” mögen, etwas schwierig, da die Helden hier ständig nach der Prämisse einer rein heroischen Vorstellung von Eigennutz handeln, oft zu ihrem unmittelbaren und dauerhaften Nachteil.
Die Helden hier sind nicht im Geringsten unmoralisch oder anarchisch (obwohl auch hier wie im Spiel der Throne relativ bedeutende Charaktere regelmäßig sterben), obwohl ihre Moral und die Einhaltung des Gesetzes uns in dieser weise fremd vorkommen. Sicher gibt es einiges an Intrigen und Bündnissen, aber der Rahmen zeigt deutlich, dass es nur auf das Streben nach Ruhm ankommt. Das klingt sehr nach Beowulf und nach anderen nordischen Sagen aus der Prosa-Edda. Es stellt sich die Frage, ob permanente Bedrohung wirklich notwendig ist, um das Beste aus den Menschen herauszuholen, und wenn man sich diese Frage stellt, dann folgt die nächste auf den Fuß: Warum wächst keiner der Charaktere an diesen Kämpfen und Herausforderungen? Mut und Heldentum gibt es im Überfluss, ebenso wie Betrug, Verrat und dunkle Künste. Aber am Ende scheinen die Schrecken und Mühen des Krieges nicht im Streben nach einer anderen Strategie für das Leben zu münden.
So einflussreich diese Geschichte auch einst war, vermisst man hier ein reicheres Heldentum, eines, das zum Wachstum fähig ist, einen Helden, der kämpft, wenn es nötig ist, der aber Kamin, Haus und gutes Essen liebt und eine Welt, in der diese gedeihen können. Ein Klassiker? Ganz klar, aber wohl eher dem Umstand geschuldet, dass es eines der ersten Bücher der High Fantasy ist und mit seiner antiquierten Sprache manche Köpfe verdreht.
Entdecke mehr von Phantastikon
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
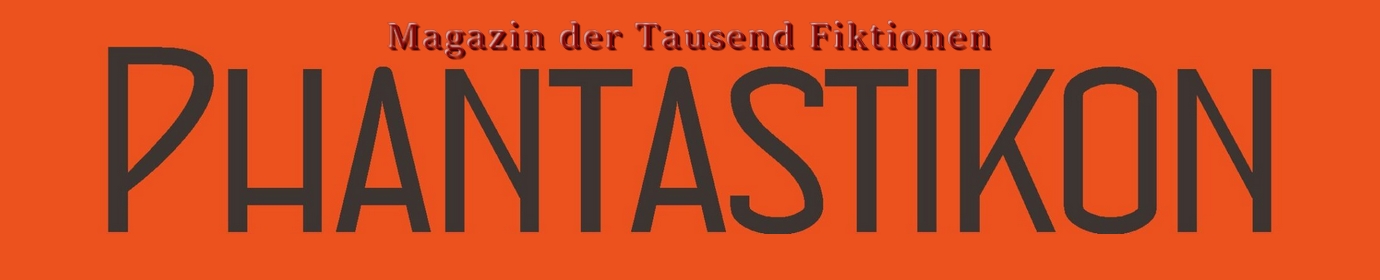
























.jpg)