Daniel Weber: Die zweifelhafte Erbschaft

Der Phantastikon-Podcast ist ein literarisch-philosophisches Format über das Fantastische in all seinen Formen – von klassischer Phantastik und Horror über Mythos und Symbolismus bis hin zu modernen Grenzbereichen zwischen Realität und Imagination. Er verbindet intellektuelle Tiefe mit erzählerischer Atmosphäre und richtet sich an Hörer, die das Denken und Träumen gleichermaßen ernst nehmen.
Es gibt Städte, die größer sind als ihre Landkarte. Wien ist eine davon. Unter den barocken Fassaden, den akkurat nummerierten Bezirken, den Grüften und Kaffeehäusern, rumort seit Jahrhunderten ein anderes Wien: ein Wien der Widergänger, der toten Engel, der verdrängten Träume. Daniel Weber hat diesem unsichtbaren Wien einen Namen gegeben: Phillipsdorf, den „verbotenen 24. Bezirk“.
Über Daniel Webers surrealen Wiener Abgrund

Es gibt Städte, die größer sind als ihre Landkarte. Wien ist eine davon. Unter den barocken Fassaden, den akkurat nummerierten Bezirken, den Grüften und Kaffeehäusern, rumort seit Jahrhunderten ein anderes Wien: ein Wien der Widergänger, der toten Engel, der verdrängten Träume. Daniel Weber hat diesem unsichtbaren Wien einen Namen gegeben: Phillipsdorf, den „verbotenen 24. Bezirk“.
Was Weber hier entwirft, ist kein Schauplatz im herkömmlichen Sinn, sondern ein lebender Organismus. Phillipsdorf ist das Übermaß der Stadt, das, was sie nicht aushält. Ein Bezirk, der nur existieren kann, weil er offiziell nicht existiert. Schon in dieser paradoxen Logik liegt sein phantastisches Prinzip: ein Ort zwischen Realismus und Wahn, zwischen Topographie und Mythos. Wo die Gothic Novel noch das Grauen in alten Mauern suchte und die Weird Fiction das Fremde als kosmischen Einbruch verstand, kommt bei Weber das Unheimliche aus der Ordnung selbst – aus Wien, das sich im eigenen Spiegel nicht mehr erkennt.
Phillipsdorf ist der Teil von Wien, der träumt, deliriert, und sich selbst überlebt. Damit knüpft Weber an eine Linie an, die von Meyrink über Kubin bis zu Schulz reicht: an jene Tradition, in der das Phantastische nicht von außen über die Welt hereinbricht, sondern aus ihrem Inneren aufquillt. In dieser Logik wird der „24. Bezirk“ zur Schwelle zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein, zwischen Geschichte und Halluzination.
Bereits der erste Band, Die zweifelhafte Erbschaft, führt den Leser in dieses Zwischenreich. Der Schriftsteller Stefan Hanns erbt das Haus seines verstorbenen Großonkels – mit der Bedingung, es zu bewohnen. Eine klassische Ausgangssituation, die Weber sogleich unterläuft. Denn das, was Hanns erbt, ist weniger Besitz als Verstrickung: eine Einladung in das, was Wien verdrängt hat. Gemeinsam mit seinem Freund Raphael Kurzhaus betritt er das Viertel, das aussieht, als sei es aus der Zeit gefallen – ein wuchernder Rest aus Schutt, Geschichte und Mythos.
Nur das geerbte Haus steht unversehrt da, beinahe zu unversehrt. In seinen Räumen wartet eine Bibliothek voller okkulter Bücher, ein Geheimnis namens „Helena“, ein halbmenschliches, halb ghulhaftes Mädchen von sechzehn Jahren und eine Nachbarschaft, die jede Vorstellung sprengt: darunter ein Vampir. Doch Weber führt sie nicht als Kuriositäten vor. Sie sind Spiegelbilder, Ausformungen einer Stadt, deren Schatten zum Leben erwacht sind.
Der Ton schwankt zwischen grotesk und ernst, zwischen schwarzem Humor und metaphysischem Schauer. Im Verlauf der Geschichte geraten Stefan und seine Mitbewohner in einen Angriff durch „weiße Diener“ – Wesen ohne Gesicht. Es ist der Moment, in dem Phillipsdorf selbst zu erwachen scheint, als hätte das Viertel genug vom Versteckspiel. Der Angriff wird abgewehrt, aber nichts ist gewonnen. Am Ende bleibt kein Abschluss, sondern ein Aufbruch: Die Erbschaft war nur der Türgriff zu einem größeren, dunkleren Raum.
Mit Phillipsdorf hat Daniel Weber ein literarisches System geschaffen, das zugleich Stadt, Spiegel und Mythos ist. Jeder Band erweitert den Bezirk ein Stück, wie ein Traum, der sich selbst weitererzählt. Die Stadt wird hier nicht beschrieben, sie wird erinnert. Und diese Erinnerung ist unzuverlässig, fiebrig, manchmal schön, manchmal tödlich.
So ist Phillipsdorf vielleicht das ehrlichste Wien der Gegenwartsliteratur – eines, das seine eigenen Dämonen nicht länger versteckt, sondern mit ihnen lebt.
Hier geht es zum ausführlichen Gespräch mit Daniel, geführt von Florian Reszner.
Entdecke mehr von Phantastikon
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
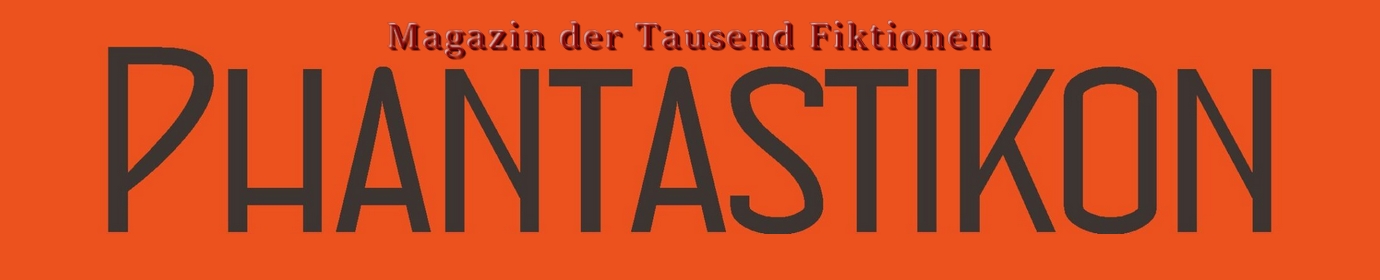
























.jpg)