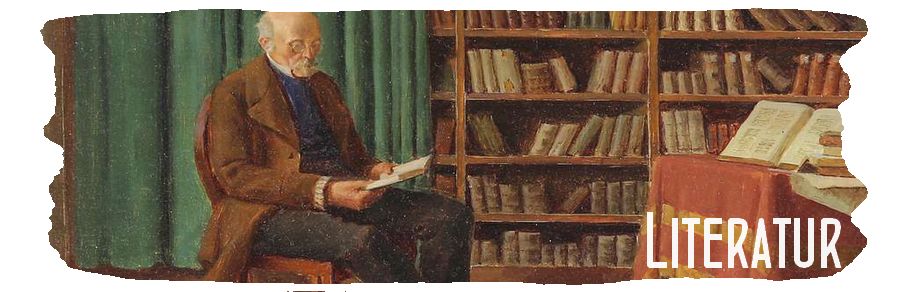Das PHANTASTIKON ist ein Kultur- und Literaturpodcast, der interessante Geschichten aufspürt. Wo immer sich also eine interessante Geschichte verbirgt, versuchen wir sie zu finden.
Es gibt Bücher, die sich dem Leser öffnen wie eine klareLandschaft: man erkennt Flüsse, Wälder, Häuser, die Menschen sind vertraut, die Geschichten leicht nachzuvollziehen. Und es gibt Bücher, die sind wie ein Spiegelkabinett. Jeder Schritt hinein verzerrt die Perspektive, die Dinge scheinen gleichzeitig vertrautund fremd, und ehe man sich versieht, blickt man nicht mehr in die Welt, sondern in die Abgründe des eigenen Bewusstseins.
Eines dieser Bücher ist Günter Grass’ „Die Blechtrommel“, erschienen 1959, mitten in einer Epoche, in der Deutschland noch in den Scherben seiner Vergangenheit stand. Doch das Buch ist weit mehr als ein Nachkriegsroman. Es ist ein okkultes Rätsel, ein Text, der sich mit jeder Lektüre neu verwandelt und der uns auf eine Reise in das Reich des Geheimnisvollen führt.
#günthergrass #blechtrommel #okkultismis #literatur
Es gibt Bücher, die sich dem Leser öffnen wie eine klare Landschaft: man erkennt Flüsse, Wälder, Häuser, die Menschen sind vertraut, die Geschichten leicht nachzuvollziehen. Und es gibt Bücher, die sind wie ein Spiegelkabinett. Jeder Schritt hinein verzerrt die Perspektive, die Dinge scheinen gleichzeitig vertraut und fremd, und ehe man sich versieht, blickt man nicht mehr in die Welt, sondern in die Abgründe des eigenen Bewusstseins.
Eines dieser Bücher ist Günter Grass’ „Die Blechtrommel“, erschienen 1959, mitten in einer Epoche, in der Deutschland noch in den Scherben seiner Vergangenheit stand. Doch das Buch ist weit mehr als ein Nachkriegsroman. Es ist ein okkultes Rätsel, ein Text, der sich mit jeder Lektüre neu verwandelt und der uns auf eine Reise in das Reich des Geheimnisvollen führt.

Beginnen wir mit der Trommel selbst. Oskar Matzerath, das drei Jahre alte Kind, das beschließt, nicht mehr zu wachsen, erhält sie zur Geburt. Von diesem Augenblick an ist die Trommel sein Begleiter, sein Werkzeug, seine Waffe. Sie ist Spielzeug und Orakel zugleich.
In vielen Kulturen gilt die Trommel als ein magisches Instrument. Sie ruft Geister, sie markiert Übergänge, sie erzeugt Trance. Schamanen schlagen sie, um die Grenze zwischen dieser und jener Welt zu überschreiten. Dass Oskar ausgerechnet mit einer Trommel die Realität zersingt, sie zerreißt, sie in Scherben legt, ist kein Zufall. Grass hat die Trommel nicht zufällig gewählt – er hat ein archaisches Symbol in die Mitte seines Romans gestellt.
Oskar bleibt klein. Er wächst nicht. Und darin liegt die erste große okkulte Dimension des Romans. Wer das Kindlich-Kleine konserviert, widersetzt sich der Zeit, widersetzt sich der Ordnung der Natur. Oskar ist ein Homunculus, eine künstliche Figur, die aus dem Strom der Geschichte heraustritt. Er ist, wenn man so will, ein Dämon im Körper eines Kindes.
Aber das Merkwürdige ist: Wir sympathisieren mit ihm. Seine Bosheiten, seine Lügen, seine Grausamkeiten haben etwas Schillerndes, fast Anziehendes. Wie im Märchen, wie in den Geschichten der Gebrüder Grimm, in denen der Trickster, der kleine Schelm, am Ende die Oberen zum Narren hält.
Und doch – hinter Oskars Spiel lauert der Tod. Erinnern wir uns an die Szenen, in denen er mit seiner Stimme Glas zersingen kann. Diese Stimme ist mehr als eine akustische Eigenart. Sie ist eine Waffe, ja, fast ein Zauber. Das Glas bricht wie die scheinbare Festigkeit der Gesellschaft. Alles, was starr ist, zerbirst vor diesem Kind.
Hier öffnet sich eine Tür in die esoterische Literaturtradition. Glas gilt seit Jahrhunderten als Symbol des Übergangs: durchsichtig und doch trennend, fragil und zugleich schneidend gefährlich, wenn es bricht. Oskars Gesang ist der Gesang des Chaos. Er durchstößt die Glaswände der bürgerlichen Ordnung.
Und da sind wir mitten in der eigentlichen Magie des Romans: Grass hat in der Blechtrommel eine okkulte Struktur verborgen. Der Text liest sich wie eine moderne Initiationsgeschichte – aber nicht die eines Helden, der auszieht, um die Welt zu retten, sondern die eines Anti-Helden, der sich dem Wachstum verweigert und mit Dämonen paktiert.
Oskar ist der Alchemist, der sein eigenes „Gold“ hütet – die Trommel. Er ist der Zauberer, der mit Stimme und Rhythmus Wirklichkeit zerlegt. Er ist der Sündenbock, der kleine Mann, der an der Schwelle von Mythen und Märchen in die Geschichte des 20. Jahrhunderts tritt.
Natürlich, die Blechtrommel ist auch ein politischer Roman. Aber das Politische ist bei Grass nie ohne das Mythische. Die Trommel schlägt den Takt der Geschichte, aber auch den Takt des Unbewussten.
Wer den Roman aufmerksam liest, erkennt darin eine Parallele zum dämonischen Puer aeternus, zum ewigen Kind, das sich weigert, erwachsen zu werden. Diese Figur taucht in Mythen und Okkultismen überall auf – von Eros bis zu Hermes, von Peter Pan bis zu modernen Tricksterfiguren. Oskar ist die deutsche Nachkriegsvariante dieses ewigen Kindes: unheimlich, unsterblich, ungebändigt.
Es gibt eine Stelle im Roman, die von Lesern oft übersehen wird. Oskar sieht sich selbst als „Scharfrichter mit der Trommel“. Schon dieser Ausdruck reicht, um den Schleier ein wenig zu lüften. Trommeln haben seit jeher eine Beziehung zur Hinrichtung, zum Krieg, zum Aufmarsch. In Oskars Händen ist sie ein Richterinstrument, ein Werkzeug des Schicksals.
Und Grass? War er sich dieser Dimension bewusst? Wir wissen, dass Grass sich intensiv mit Märchen, mit Mythen, mit Symbolen beschäftigt hat. Er war kein okkulter Schriftsteller im eigentlichen Sinne, aber er wusste um die Macht der Archetypen.
Die Blechtrommel ist deshalb mehr als eine „deutsche Familiensaga“. Sie ist eine okkulte Parabel. Sie zeigt, wie das Dämonische in die Geschichte hineinwirkt – und wie die Geschichte selbst etwas Dämonisches trägt.
Einige Literaturwissenschaftler haben darauf hingewiesen, dass Oskar ein „Mephisto im Kinderformat“ ist. Er verführt, er lügt, er manipuliert. Aber er tut es nicht als Fremder – er tut es von innen heraus. Das Okkulte liegt hier nicht im Hexenkult, nicht in Zauberformeln, sondern in der alltäglichen Verschiebung der Wahrnehmung. Oskar ist der Magier des Banalen.
Wenn wir den Roman so lesen, dann wird die Blechtrommel selbst zu einem Grimoire – einem Zauberbuch. Wer es liest, ist gefangen im Bannkreis von Oskars Stimme, Oskars Blick, Oskars Trommelschlägen.
Und das Rätsel? Es bleibt offen. Denn Oskar wächst ja schließlich doch. Am Ende, nach all den Jahren, nach all den Toden, nach all den Glasbrüchen, setzt das Wachstum wieder ein. Aber es ist ein Wachstum ins Schiefe. Oskar wird nicht groß, er wird krumm. Wie eine Pflanze, die im Dunkeln wuchs.
Das ist vielleicht das dunkelste Geheimnis der Blechtrommel: dass das Verweigern des Wachstums, das ewige Kindsein, nicht zur Erlösung führt, sondern zur Verzerrung. Oskar ist ein Dämon, ja – aber er ist auch ein Opfer seines eigenen Zaubers.
Und so steht dieser Roman heute noch da wie eine schwarze Monolith-Trommel. Man kann ihn politisch lesen, psychologisch, realistisch – aber hinter all diesen Schichten pocht ein okkultes Herz. Ein Herz, das uns zuflüstert: Die wahre Magie der Literatur besteht darin, uns zu zeigen, wie nah das Geheimnisvolle immer bei uns ist.